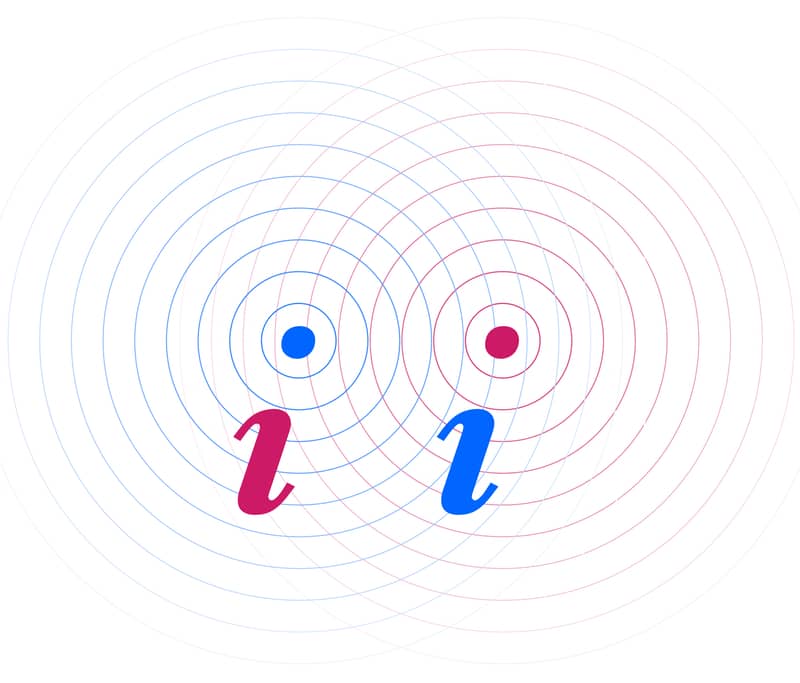„Wer bekommt, was er mag, ist erfolgreich.
Wer mag, was er bekommt, ist glücklich.“
Martin Luther
Es ist Januar 2013. Ein Jahr später. Regenzeit. Diesmal in Indonesien. Im Herzen Sulawesis hat der Wettergott gerade ein Einsehen. Wolken- und Nebel verhangen präsentiert sich das Hochland von Toraja den wenigen Touristen, die sich um diese Jahreszeit hier her verirren. Eine enge, kurvige Straße. Oder bessere gesagt das, was die Regenfluten der letzten Wochen davon übrig gelassen haben. Die Hoffnung, dass es nach der nächsten Kehre besser wird mit den Asphaltlöchern oder zumindest kein Gegenverkehr kommt. Blitzlichter und Erinnerungsfetzen an Fernsehberichte über Reisen auf dem Karakorum-Highway oder die Pan-Americana und die Erleichterung, dass im Unterschied zu diesen berühmt berüchtigten und unfallreichen Straßen der Welt es hier ja so gut wie kein Verkehrsaufkommen gibt. Bis auf paar Mopeds und eine kleine Autokarawane mit vergnügten Hochzeitsgästen, die wir am Straßenrand stehend vorbei lassen, den ganzen Vormittag kein Gegenverkehr.
Und dann, kurz vor der 1400 Metermarke das Mädchen. Eine Autostopperin, der der Fußweg ins Tal zu beschwerlich zu sein scheint und die ihr Glück versucht und den Daumen rausstreckt. Wir bleiben stehen, stecken die Köpfe beim offenen Autofenster raus und ernten einen leicht entsetzten, hysterischen Schrei und darauffolgend verlegenes Gekichere. Aber das nur mehr in Fetzen, da die dunkelgelockte Jugendliche das Weite sucht. Wir können zwar nicht verstehen, was sie sagt, da dazu die paar mühsam erlernten indonesischen Floskeln noch nicht ausreichen, aber ihre Reaktion lässt darauf schließen, dass sie hier nicht mit weißen Touristen gerechnet hat. Ja, vielleicht auch noch nie welche so nah gesehen hat. Wieder eine Fremdbegegnung in Südostasien, von denen es in den vergangenen Jahren unzählige gegeben hat.
Ein paar Tage zuvor. Die Emirates Lounge in München. Ein Abbild der Fluglinie aus Dubai – dynamisch, expansiv und ständig ein bisschen anders. Die Großmutter hat im Sommer ihre letzte Reise in eine andere Welt angetreten. Erinnerungen an Episoden mit ihr sind auch in diesem Jahr Wegbegleiter. Die Flugverspätung wurde bereits beim Check-in angekündigt, ist aber nicht weiter tragisch, da wir in Dubai fünf Stunden Wartezeit auf den Weiterflug nach Jakarta absitzen müssen. Heute auf den modernen Terminals ist das Warten ja auch sehr kurzweilig. Langsam füllt sich das Gate in München mit Leben. Dinner gibt es an Bord des supermodernen A 380, mit dem Emirates seit drei Jahren die Strecke München – Dubai täglich bedient. Seit Sommer 2014 fliegt der A380 zweimal pro Tag die Distanz von knapp 5000 Kilometern. Fast immer gut gebucht.
Hoch über Österreich macht sich eine erste Vorfreude auf das noch Unbekannte bemerkbar. Die Emirates Fluroute von München in die Vereinigten Arabischen Emirate am persischen Golf führt genau über unser Haus im Innviertel. Bei klarem Wetter können wir den A 380 täglich zweimal von unten bestaunen. Die Gedanken an die letzten Arbeitstage und den Stress vor Abflug verblassen. Und dann, nach gut 20 Stunden und der üblichen Wackelei über dem indischen Kontinent ankommen: Tropengewitter in Jakarta, die ganze Stadt steht wieder einmal, für diese Jahreszeit typisch, unter Wasser. Es ist schwül und feucht. Der Weiterflug nach Makassar mit Garuda Indonesia kurzweilig und trotz Tropenschauer recht ruhig. Raus aus der Komfortzone. Rein ins Großstadtleben der Millionen- und Hauptstadt der Insel. Aber wo ist die Großstadt? Auf der Fahrt vom Airport Sultan Hassanudan in die Innenstadt zeigt sich der Moloch von seiner unansehnlichen Seite. Schmutzige Häuserfassaden, Bauruinen, Müll entlang der Straßen und das übliche Moped- und Autogewirr sowie lautes Gehupe prägen das Stadtbild von Ujung Pandang, wie Makassar früher hieß. Eine Innenstadt sucht man vergeblich. Neben ein paar Sehenswürdigkeiten, die manchmal schwer als solche zu identifizieren sind, hat die Stadt an der Makassar Straße, die die Celébessee im Norden mit der Javasee verbindet, wirklich nichts zu bieten außer ein paar indonesische Restaurants und Bars mit lauwarmen Bier. Hoffentlich die Insel mehr.

Sulawesi – früher Celebes – gehört zu den indonesischen Inseln und liegt mit einer Fläche von 189.216 Quadratkilometer und rund 17 Millionen Einwohnern zwischen Borneo und Neuguinea. Die Islamisierung der bis dahin buddhistischen und hinduistischen Insel begann im 15. Jahrhundert. Mittlerweile praktiziert die Mehrheit der Muslime in Sulawesi einen orthodoxen Islam nach arabischem Vorbild mit sehr liberalen Ausprägungen. Die Menschen mit protestantischem Glauben leben überwiegend in Zentral-Sulawesi – rund 28 Prozent – und in Nord-Sulawesi – rund 60 Prozent. Wie überall auf der Welt konzentriert sich die Bevölkerung im Südwesten rund um die Hauptstadt Makassar und im Norden um Kota Manado, Kota Gorontalo, Poso, Palu und Luwuk.
Die Insel, die von ihrer Form her an einen Kraken oder eine Orchidee erinnert, ist vulkanischen Ursprungs und stark gegliedert. Im Westen liegt Borneo, im Osten die Inselgruppe der Molukken, im Süden Flores. Besiedlungsnachweise sind ab rund 30.000 vor Christi Geburt belegt. Die ersten Europäer waren portugiesische Seefahrer, die im Jahre 1525 auf der Suche nach Gold von den Molukken kamen. Ein knappes Jahrhundert später landeten die Niederländer, gefolgt von den Engländern, die in Makassar eine Handelsniederlassung gründeten. Ab dem Jahr 1660 waren die Niederlande im Krieg mit Gowa, der damals wichtigsten Makassar-Macht an der Westküste. Im Jahr 1669 zwang Admiral Speelman den Herrscher von Gowa, Sultan Hasanuddin, dem Namensgeber des Flugfhafens, mit der Unterzeichnung des Vertrages von Bongaya, die Kontrolle des Handels an die Niederländische Ostindien-Kompanie zu übergeben. Unterstütz wurden die die Niederländer von den Bugis unter Arung Palakka, deren Siedlungen sich heute im Toraja Hochland konzentrieren. Im Jahr 1905 wurde die gesamte Insel bis zur Japanischen Besatzung im zweiten Weltkrieg Teil der niederländischen Kolonie Niederländisch-Indien. Nach Kriegsende war Sulawesi Teil der unabhängigen Vereinigten Staaten von Indonesien, die sich im Jahr 1950 in die Republik Indonesien umwandelten.
Die Fahrt vom Hotel an der Küste zum Avis-Office wird zur regelrechten Rundreise durch die Millionenstadt. Denn am Flughafen gibt es entgegen der Ankündigung auf unserem Buchungsschein kein Büro der internationalen Autoanmietestation. Zum Glück findet der Taxifahrer nach mehreren Telefonaten und mehr als einer Stunde Irrfahrt durch den Stadtteil Gowa das Büro in einem versteckten Hinterhof. Die Beschäftigten dort wissen nichts von der Buchung. Nach einigem Hin und Her, taktieren und verhandeln, ob den bar oder mit Kreditkarte bezahlt werden soll, nehmen wir unseren rotbraunen Avanza in Besitz. Ist nicht das neueste Modell mit rundherum Blessuren, aber er fährt. Und das gut und verlässlich, auch wenn dort und da immer wieder einmal rote Lampen am Armaturenbrett aufleuchten. Das Navigationsgerät, das uns der Freund des Mitarbeiters, den er zwecks Englisch-Übersetzung angerufen hatte, mit den besten Wünschen für eine gute Fahrt noch in die Hand gedrückt hat, bevor wir den Hinterhof verlassen, spricht indonesisch. Unser Kompass, verlässlicher Reisebegleiter, und die Karte, die das Navigationsgerät anzeigt, erweisen sich in ihrer Zusammenarbeit hilfreich. Trotz der Sprachschwierigkeiten. Als wir dann auch noch nach gut fünf Stunden vor Sonnenuntergang im Gewühl der nicht asphaltierten Nebenstraßen und Menschenmengen und mit den letzten Tropfen Benzin im Tank unser Hotel wieder finden, Erleichterung. Denn die Tankstelle gleich um die Ecke, die uns die beiden Männer vor Abfahrt beschrieben hatten, da beim Anstarten des Motors klar war, dass der Tank leer ist, haben wir nicht entdeckt.
Zwischendrin, mitten im Verkehrschaos, sind in uns Gedanken und Erinnerungen wach wachgeworden an den ersten Urlaub in Indonesien vor gut zwanzig Jahren und die Autoanmietung am Jakarta Airport. Damals gab es ebenfalls – obwohl reserviert – kein verfügbares Auto am Flughafen-Counter. Deshalb mussten wir in die Stadt rein. Es folgte eine lange Taxi-Fahrt über schlechte, enge, nicht asphaltierte Straßen. Wir hatten den Eindruck, als wenn uns der Fahrer ans andere Ende der heute nur im Zentrum knappe 10 Millionen Einwohner zählenden Stadt – im Großraum Jakarta lebten übrigens 2014 an die 30 Millionen Menschen – bringen würde. Es folgte ein eine gefühlte Ewigkeit dauerndes Verhandlungs-Procedere über den Mietpreis. Zwei Stunden Aufenthalt auf der Bank wegen Geldwechseln, weil das Auto bar bezahlt werden wollte. Und dann die ersten Kilometer ohne Navi und Karte im Moloch Jakarta bei pünktlich um 16 Uhr einsetzenden Tropenregen. Das erste Mal links fahren war da noch der geringste Stress. Darüber lachen wir heute am Abend auf der Terrasse des etwas in die Jahre gekommen Golden Makassar Hotels mit Blick auf die Boote, die im Hafen der Straße von Makassar gemächlich vor sich hin tümpeln. Es weht ein laues Lüftchen. Im Gegensatz zu Kota Kinabalu mischen sich hier an der Hafenpromenade – fast wohlriechend – die Auto- und Moped-Abgase mit dem Geruch des salzigen Meeres. Zuvor haben wir noch eine Mail an Camilla in Bira geschickt, dass wir einen Tag früher als gebucht kommen wollen, da ein weiterer Tag in der Millionenstadt Zeitverschwendung wäre.

Weil wir beim Verlassen der Stadt der Navi-Stimme und nicht der Intuition folgen, macht der Weg nach Bira einen ordentlichen Umweg auf schlechten, anfangs dicht befahrenen Straßen. Entlang von Reisfeldern und Palmenhainen. Aus geplanten acht Stunden werden zwölfeinhalb. Aber wir kommen an in dem kleinen Ort im Süden von Sulawesi. Schneller als unsere Mail, die Camilla nicht erreicht hat. In der Nebensaison aber kein Problem, da in dem schönen Steinhaus an den Klippen Zimmer frei sind und wir unseres in vorderster Front direkt an den Klippen mit Blick auf das Meer unter uns beziehen können. Das Haus mutet in Architektur und Bauweise mediterran an, und wüssten wir nicht genau, dass wir auf Sulawesi sind, könnte das Hotel auch irgendwo auf Mallorca oder in Andalusien stehen.
Die türkisfarbene Java-See lässt vermuten, dass es hier schöne Tauch- und Schnorchelreviere gibt. Von Bira legen auch die Fähren auf die vorgelagerten Inseln und nach Labuan Bajo ab. Das stürmische Wetter verhindert die nächsten Tage aber hartnäckig, dass wir mehr als bis zu den Knien ins Wasser kommen. Camilla hat uns beim Check-in ja auch erzählt, dass das Hotel in der Regenzeit eigentlich geschlossen ist. Heuer wollte man erstmals den Versuch starten, und testen, ob sich doch Gäste hierher verirren, da das Wetter ja nicht immer schlecht ist. Hat geklappt, der Versuch. Wir kommen zwar nicht ins Wasser, es verstärkt sich aber der Verdacht, dass das hier in der Trockenzeit ein schönes Erlebnis sein muss: schnorcheln und baden. Und wir nutzen die Zeit, an der Küste entlang zu wandern, den Männern beim Bootsbau zuzuschauen und erleben auch hautnah einen kleinen Tropensturm, der übers Meer hereinfegt und die Palmen und alles, was sich ihm in den Weg stellt, gefährlich beutelt.

Nach zwei Tagen führt die abenteuerliche Fahrt wieder zurück Richtung Norden nach Watampone, oder Bone, wie die Einheimischen hier sagen. Da wir von anderen Reisen bereits geübt sind in der Langsamkeit der Fortbewegung auf schlechten und zum Teil nicht vorhandenen Straßen, genießen wir die Fahrt. Im Baustellenbereich zwischen Bira und Sinjai nur Schritttempo. Insgesamt auf der Fahrt in Richtung Zentralsulawesi wechselt mit Höchstgeschwindigkeiten zwischen 30 und 35 Kilometern pro Stunde. Streckenweise sind wir alleine unterwegs. Orte kündigen sich immer insofern an, als dass der Verkehr dichter wird und plötzlich wie aus dem Nichts unzählige Mopeds auftauchen. Zwischendrin sind zu jeder Tageszeit Massen von Kindern unterwegs, die gerade von der Schule heimgehen. Wie lang die offizielle Schulzeit dauert, ist schwer herauszufinden, da irgendwer irgendwo immer unterwegs ist. Die Heranwachsenden zeigen sich jedenfalls von dem dichten Verkehrstreiben unbeirrt. Machen nur einen Schritt zur Seite, wenn ein dicker Brummi sich mit Hupsignalen einen Weg durch die Dörfer bahnt.
Die Hupe in unserem Auto funktioniert nicht, beziehungsweise nur, wenn sie Lust dazu hat. Und das ist selten. Zum ersten Mal in unserem Leben, das uns ja bei der Führerscheinprüfung schon gelehrt hat, die Hupe nur in äußersten Notsituationen anzuwenden, vermissen wir den Krachmacher. Wäre manchmal schon hilfreich, ein Signal abgeben zu können. Zum Glück ist es ein fast ein Regen freier Tag. Bis auf einen kurzen Tropenschütter ist der Himmel nur leicht Wolken verhangen. Watapone erreichen wir direkt, da wir uns heute nicht auf das Navigationsgerät, sondern auf die Karte und den altbewährten Kompass verlassen – und auf unser Gefühl.

Die Fahrt von Wontapone nach Sengkang entlang üppiger Reisfelder ist wie eine Fahrt durch das große Dorf Sulawesi. Das Leben spielt sich entlang der Straßen und Flüsse ab, die Dörfer scheinen keinen Anfang und kein Ende zu haben. Es geht dahin mit Tempo 25, genau die richtige Geschwindigkeit, um viel von der Umgebung mitzubekommen und trotzdem die Konzentration auf den Verkehr und die Straße zu haben. Die kleine Stadt mitten auf Sulawesi erreichen wir dann erst gegen vier Uhr Nachmittag, schon zu spät, um den nahegelegenen 130 Quadratkilometer großen Tempesee noch zu besuchen. Das Perdok Era Hotel, das einzige Haus in der muslimischen Stadt, in dem es auch ein kühles Bier gibt, ist einfach und nett. Gleich um die Ecke befindet sich ein kleines Warung, in dem hungrige Mägen Berge von Reis und gebratene Nudeln finden. Der Weg dahin führt uns über den Markt. Wir merken, dass sich hierher nicht viele weiße Touristen verirren, da wir sichtbar bestaunt und immer wieder mit einem freundlichen „hello sir“ begrüßt werden. Lachende Gesichter inklusive. Das Einschlafen wird melodisch begleitet vom Singsang des Muezzins.
In der Nacht verführen die monotonen Regentropfen auf dem Blechdach zu Nachdenken über Zeit und Achtsamkeit bevor um 4.30 Uhr der Muezzin wieder das Kommando übernimmt. Im Dämmerschlaf fällt mir ein, dass die Suchmaschine beim Googeln nach dem englischen Begriff von Achtsamkeit – mindfullness – kurz vor Weihnachten mehr als 28.000.000 Ergebnisse ausgeworfen hat. Beim deutschen Begriff Achtsamkeit waren es immerhin noch rund 815.000 Treffer. Ein Thema, das in der westlichen Welt offensichtlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Eine Haltung, die die Südostasiaten auch hier auf Sulawesi in vielen Bereichen des Lebens verinnerlicht und integriert haben. Die damit verbundene Aufmerksamkeit ist überall präsent, am meisten erstaunt uns immer, dass sich Menschen, die im Service arbeiten, die kleinsten Kleinigkeiten merken und den Gast dann am nächsten Tag genau mit diesen überraschen. Dabei haben sie offensichtlich Freude, wenn sie Freude bereiten können. Und das nicht nur beim gut ausgebildeten Personal in teuren Hotels, wo man das ja auch erwarten darf, sondern überall, auch in den kleinsten Straßenlokalen oder Strandrestaurants, die sich sehr oft mit Wanderarbeitern oder Familienmitgliedern über die Runden helfen.

Die Theorie beschreibt Achtsamkeit als eine spezielle Form der Aufmerksamkeit. Und zwar ganz gegenwärtig und bei dem zu sein, was von Moment zu Moment in unserem Körper, in unseren Gedanken und Gefühlen geschieht, jedoch ohne sich darin zu verlieren oder das Wahrgenommene vorschnell zu bewerten. Absichtsloses Hinschauen und Beobachten. Achtsamkeit in Asien an vielen Orten gelebter Alltag, hat in den Kursen und Seminaren der westlichen Welt, die Achtsamkeit lehren, das Ziel, mehr Handlungsspielräume, mehr Bewusstsein und mehr persönliche Freiheit zu erlangen. Die Wurzeln von Achtsamkeit liegen im Buddhismus. Das Wort selbst kommt aus dem Sanskrit. Sie liegt als aufmerksamkeitsbezogene Haltung den meditativen Praktiken aller buddhistischen Traditionen zu Grunde. Die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit, die Gegenwärtigkeit, die Akzeptanz ohne keine Bewertung und Urteile und der Abstand zwischen dem inneren Beobachter und dem Beobachteten sind die wesentlichen Grundlagen achtsamen Handelns. Forschergeist, Neugierde und Entschleunigung sind Wesensmerkmale.
In der Regel bestimmt unsere Wahrnehmungslandkarte, unsere mentalen Modelle und die blinden Flecken, die jeder hat, worauf wir unsere Wahrnehmung richten. Kennen wir alle: man sieht nur das, was man gerne sehen möchte, was eigene Annahmen stützt und (Vor)Urteile bestätigt. Wir befinden uns dann gedanklich oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das wirkliche Leben findet aber in der Gegenwart statt. Die Achtsamkeit als „Methode“, so wie sie in unzähligen Seminaren, Lehrgängen, Managementkursen und zur Entspannung und Stressbewältigung gelehrt wird, ermöglicht uns, unsere „Autobahnen“ und verschlungenen Pfade aufzuspüren und sie auch zu verändern. Das erforscht auch immer mehr die moderne Hirnforschung, fällt mir im Halbschlaf ein. Gleichzeitig fällt mir auf, dass sowohl das Plätschern am Dach als auch der Muezzin aufgehört haben, die Menschen der Stadt zum Gebet zu rufen. Dafür zwitschern die Vögel und begrüßen den neuen Tag. Da eine weite Tour ansteht, wird es langsam Zeit, aufzustehen.

Die Straße von Sengkang Richtung Nordosten nach Palopo ist besser ausgebaut als die bisherigen. Kurz vor Mittag erreichen wir die Stadt am Meer, von der aus es in die Berge nach Rantepano ins Toraja Land geht. Nach kurvenreichen 55 km über eine Gebirgsstraße, die in den Reiseführern als atemberaubend beschrieben wird, uns „fast Gebirgler“ aber nicht wirklich beeindruckt, kommen wir in der auf gut 1100 Metern liegenden Stadt im Torajaland an. Ratepano mit seinen mehr als 43.000 Einwohnern präsentiert sich als eine einzige große Baustelle. Der Hauptort des Regierungsbezirks Nordtoraja – Toraja Utara – ist seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts kulturelles und touristisches Zentrum der Region und Sitz der Volksgruppe der Toraja. Insgesamt leben in der Region um die 250.000 Menschen, zum Teil weit verstreut in abgelegensten Berggebieten, von denen die höchsten auf mehr als 3000 Metern liegen. Tana Toraja ist die Heimat der Bugis, die damals um Makassar kämpften, von den Holländern missioniert wurden und heute überwiegend Christen sind. Unschwer zu erkennen, wenn man durch die Gegend fährt, an unzähligen kleinen Kirchen vorbei. Bei genauem Hinschauen entdeckt man aber überall auch animistische Religionsrelikte der Aluk Todolo Religion.

Nach dem Glauben der Toraja ist das Leben im Diesseits nur ein Übergang. Das was zählt, ist das Leben danach. Deshalb werden auch wochenlang Totenfest gefeiert, manchmal müssen die Verstorbenen viele Wochen – einbalsamiert in ihren Wohnräumen – warten, bis der gesamte Familienclan zusammen ist, um Abschied zu nehmen. Viele junge Toraja sind nämlich mit dem Wirtschaftsboom unter Suhartos „ Neuer Ordnung“ Mitte der 60er Jahre nach Kalimatan, Papua , Sulawesi oder Java gegangen, um dort in den Unternehmen ausländischer Investoren zu arbeiten. In der Holz und Ölindustrie, im Bergbau oder im Dienstleistungsbereich. Mit steigender politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Indonesien in den späten 1990er Jahren einschließlich religiöser Konflikte auf Sulawesi ging der Tourismus in Tana Toraja dramatisch zurück, was weitere Abwanderungen vor allem der jungen Bevölkerung zur Folge hatte.
Den Ortskern von Rantepano haben wir in dem Gewirr an Bauarbeiten bis zum letzten Tag nicht gefunden. Das Hotel Misiliana am südlichen Ortsrand aber dank Navi ganz schnell. Es ist einladend. Zwar schon etwas in die Jahre gekommen, doch der wunderschöne Garten mit kleinen Toraja-Häusern eingebettet zwischen Kalkstein- und Schieferfelsen und einer grünen Tropenlandschaft lässt über die nicht funktionierende Dusche hinwegsehen. Die Nacht ist ruhig, am frühen Morgen trinkt ein bunter Kolibri aus der Blütenbracht vor unserem Balkon. Das Wetter ist gut, was für die Gegend im zentralen Bergland, das aufgrund seiner Lage nahe des Äquators das ganze Jahr über starke Niederschlägen ausgesetzt ist, gar nicht typisch ist. Schon gar nicht in der Regenzeit.

Die Fahrt im Schritttempo nach Kete Kesu südöstlich von Ratepano ist schön und bringt eine gute Fotoausbeute mit vielen Reisfeldern und traditionellen Toraja-Häusern. „Diese Häuser mit ihren kunstvollen Schiffsdächern zeugen von der Vergangenheit des Seefahrervolkes“, erzählt uns Riman, der für ein kleines Trinkgeld in gutem Englisch und sichtbar auch gerne und stolz über seine Vorfahren erzählt. „Heute leben die Menschen hier überwiegend vom Nassreisbau und der Schweine- und Büffelzucht“, weiß der junge Mann zu berichten. „Letztere vor allem für die unzähligen zeremoniellen Opfer bei Feierlichkeiten und Begräbnissen und für den Eigenverbrauch. Sie gehören als Kleinbauern zur Schicht der Besitzlosen, der Tobuda. Rund ein Viertel der Bevölkerung gehört zu der landbesitzenden Mittelschicht, den Tomakaka, was so viel wie älterer Bruder heißt. Etwa fünf Prozent sind Tokapua, also landbesitzender Adel.“ Und mit einer Handbewegung in Richtung seiner Brust sagt Rima, dass er zu den ersteren gehört. Wir haben das so vermutet. „Ein typisches Dorf“, geht die improvisierte Führung weiter, „besteht aus zwei parallel verlaufenden Häuserreihen in Ost-West-Richtung“.

Und unser indonesischer Guide, der sich uns einfach angehängt hat und drauf los erzählt, demonstriert uns mit wilder Gestik anhand der Objekte vor uns, wie die Häuseranordnung zu erfolgen hatte. „Die Wohnhäuser“, sagt Riman, „sind ausgerichtet nach Norden und stehen auf eckigen Holzpfählen den Göttern entgegen. Die Reisspeicher werden von runden Pfählen getragen. Die Zahl der Büffelhörner an den Giebeln der Häuser, die traditionell ohne Nägel hergestellt und mit Stroh gedeckt sind, zeugen von der sozialen Stellung der Familie.“ Die kunstvoll geschnitzten Verzierungen der Häuser und Reisspeicher beeindrucken uns wirklich. Und Riman freut sich, als wir ihm das auch sagen. Und noch mehr über das zusätzliche Trinkgeld, das er gut brauchen kann. Fünf Geschwister und er sind zu Hause zu ernähren. Als Ältester in der Familie macht er neben der Feldarbeit auch Touristenführungen, um die Eltern zu unterstützen.

Dass man nicht wirklich viele Dinge zum Leben braucht, lernen wir hier auch. Aus der Erzählung des jungen Mannes, aber auch in unserem Reise-Alltag. Autofahren ist auch ohne Dauerbeschallung, Musik und Radio möglich. Nach einiger Zeit beginnt man die Stille zu genießen. Ein Fernseher, auch im Dreisternehotel, ist absoluter Luxus. Wozu auch, wenn es maximal einen Sender und manchmal keinen Strom gibt. Zum Essen reichen ein bisschen Reis und eine Sauce drauf. Und wenn man den Reisbauern bei der Arbeit zuschaut, beginnt man jedes einzelne Korn mit anderen Augen zu sehen und zu schätzen.

Sonntag ist Kirchentag und es ist ruhig in Toraja. Die Fahrt führt uns heute Richtung Nordwesten in die Berge hinauf. Kurz nach Rantepano schaltet sich der einzige Radiosender wieder aus. Schade, da gerade Gospelgesänge, die den sonntäglichen Gottesdienst umrahmen, übertragen werden. Auf 1390 Meter über dem Meer. Wir fahren über eine atemberaubende Bergstraße, die wirklich eine ist. Tasten uns entlang der Reisterrassen, die wegen ihrer beeindruckenden Schönheit zum Unesco-Welt-Naturerbe erkoren wurden. Manchmal kommen wir dem Abgrund gefährlich nahe. Vor allem dann, wenn ein Auto entgegen kommt. Für zwei nebeneinander sind die Straßen hier nicht gemacht. In den Toraja-Dörfer entlang der Straße gibt es schönen Lontas zu sehen. Manche noch sehr ursprünglich mit Stroh, die meisten aber bereits mit Blech gedeckt. Jeder Ort hat seine Kirche, aus denen heute Gebetsfetzen und manchmal auch Choräle tönen. Und natürlich eine kleine Schule mit sauber gefegtem Schulhof. Auch Indonesien hat Schulpflicht.

Je höher wir kommen, umso mehr fragen wir uns, wie es möglich ist, auf diesen Steilhängen Reisfelder zu bewirtschaften und vor allem, wie man davon leben kann. Landschaftlich gehört die Region sicherlich zum Schönsten, was Asien zu bieten hat. Hier leben und arbeiten muss eine wirkliche Lebensaufgabe sein. In einigen Orten ist die Kirche vorbei. Festlich gekleidete Frauen und Kindern mit Gebetsbüchern unterhalten sich am Nachhauseweg. Männer sind nur wenige zu sehen. Die sind am Feld, denn die Feldarbeit kennt keinen freien Tag. Am Rückweg nach Tigali treffen wir das autostoppende Mädchen. Wir hätten sie gerne mitgenommen. Sie hat es vorgezogen, die Flucht zu ergreifen.

Am nächsten Tag geht die Reise zurück in die Hauptstadt Sulawesis. Die 300 Kilometer weite Fahrt von Toraja nach Makassar führt durch eine faszinierende Obst- und Gemüselandschaft. Langsam schlängelt sich die Straße von der Hochebene hinunter in das fruchtbare Tal und weiter dem Meer entgegen. Links und rechts gesäumt von sanften Hügeln und präzise angelegten Feldern. Die Schlaglöcher werden weniger. Der Küste entlang ist die Straße dann ein Stück sogar zweispurig und erlaubt auf den letzten Kilometern eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. Die erreichen wir nicht einmal beim Stopp am Heimweg nach Europa in Dubai. Dort braucht der sicht- und hörbar genervte Taxifahrer für die 20 Kilometer vom Jumeirah Beach nach Bur Dubai auf der sechsspurigen Sheik Sahid Road – wohlgemerkt in eine Richtung – länger als eine Stunde. Ist alles relativ, hat Albert Einstein schon herausgefunden.
Die mehr als 1500 Kilometer über kaputte, enge, staubige und zum Teil gar nicht mehr vorhandene Straßen haben müde gemacht. Die Begegnungen mit den Menschen waren schön und herzlich. Im Durchschnitt sind wir fast täglich sieben Stunden im spartanischen Avanza gesessen. Der hat gute Dienste geleistet, auch wenn manchmal ein Lämpchen aufgeleuchtet hat und wir auf den letzten Kilometern noch beinahe die Aufhängung für das Reserverad verloren hätten. Und wieder mal bemerkenswert, dass wir keinen einzigen Unfall gesehen haben. Jetzt freuen wir uns auf die letzte Station auf Sulawesi. Und werden enttäuscht.
Schon bei der nächtlichen Fahrt ins Hotel mitten in Manado fällt uns auf, dass ganze Straßenzüge vor kurzen unter Wasser gestanden haben müssen. Der Taxifahrer muss auch einige Umwege fahren, damit wir ins Hotel gelangen. Das Wetter ist aber gut, soll auch die nächsten Tage schön sein. Und so sind wir frohen Mutes, als wir am nächsten Tag auf den Fahrer warten, der uns zum Hotelboot am Hafen bringen soll.

Der war noch pünktlich. Und hat uns den Weg durch die Stadt mit dem nostalgischen Eagles-Song Hotel California versüßt. Ein Lied, das uns auf den Reisen der letzten dreißig Jahre in unzähligen Variationen immer wieder begleitet hat, da die Asiaten nach wie vor auf amerikanische Pop-Musik stehen. Seit einigen Jahren auch in den wuchernden Karaoke Bars. Manchmal ist das Original der kalifornischen Band, in dem das Hotel California vermeintlich die Ideale des American beziehungsweise Californian Way of Life romantisiert, der sich bei näherem Hinschauen und Hinhören jedoch als Albtraum und Entlarvung der Dekadenz herausstellt, nur mehr schwer zu erkennen. Diesmal war es eine Originalaufnahme vermutlich auf einer „Sicherungskopie“.
Das Warten auf die Abfahrt des Bootes stellt uns, dann auf eine erste Geduldsprobe gestellt. Wir warten gute zwei Stunden auf Evelyn. Die blonde Holländerin, die uns zusammen mit zwei Bootsmännern zur Insel bringen soll, muss noch shoppen gehen. Aus angekündigten 30 Minuten werden mehr als zwei Stunden. Offenbar hat sie nicht gleich gefunden, was sie suchte. Wir nutzen die Zeit, wie es sich für Europäer gehört, sinnvoll, und schauen uns am Markt am Hafen um. Ein typisch asiatischer Markt, auf dem es von Lebendgetier, zusammengepferchten, halbtoten Hühnern, Eiern, Gemüse und frisch geschlachteten Tieren auch Kleidung, Kleinwerkzeug und Baumaterialien gibt. Der Blick ins Hafenbecken lässt uns Schlimmes ahnen. Unmengen von Unrat haben sich hier im seichten Wasser angesammelt. Und tatsächlich müssen wir aufgrund der Ebbe durch den Müllberg im Wasser waten, um zu dem kleinen Boot zu gelangen. Evelyn lässt sich von einem der Guides tragen. Wir marschieren tapfer durch. Als dann auch noch die Ausfahrt durch ein parkendes Boot blockiert wird, bewegt sich unsere anfangs noch gute Laune langsam gegen den Nullpunkt. Und schließlich wird der auch erreicht, als wir nach einer guten Dreiviertelstunde Fahrt und mit mehr als drei Stunden Verspätung auf Bunaken Island zusteuern.

Bei der Einfahrt durchs Riff Richtung Strand des Bunaken Dive Resorts ein ähnliches Bild wie zuvor am Festland: Dreck, Plastik, Unrat, Holzvertäfelungen, Baumstumpfe und alles, was die Menschen achtlos wegwerfen, scheint hier die letzten Tag gestrandet zu sein. Das Hotel wirkt extrem ruhig. Muss es auch, da wir die einzigen Gäste sind. Als uns die junge Holländerin, die, wie sich später herausstellen sollte, seit einem Jahr auf der Insel lebt und die Manager in ihrer Arbeit unterstützt, auch noch mit einem breiten Grinser meint: „Welcome to the paradise Bunaken“ kann ich mir die Frage nicht verkneifen, wo denn da das Paradies ist. Ein bisschen irritiert meint sie „here“ und deutet mit der Hand auf das im Wasser herumschwimmende Plastik. „You can go snorkeling.“
Als sie uns beim verspäteten Mittagessen die Fotos vom Sturm zeigt, der vor knapp zwei Wochen über den Norden Sulawesis und auch über die Insel gefegt ist, stimmt sie uns wieder gnädig. Sie erzählt von den Zerstörungen rund um Manado und den Unmengen von Müll, die dadurch ins Meer gespült worden sind. „Die Stadtverwaltung hat einfach den Damm oberhalb der Stadt geöffnet“, beschreibt sie, was passiert ist. Und die Wassermassen haben die Stadt Manado – ohne Vorwarnung – überflutet und horrende Schäden angerichtet. Es wird noch Wochen dauern, bis diese wieder einigermaßen behoben sind. Im Fernsehen hat man davon nichts gesehen. Sonst hätten wir vermutlich den Reiseplan geändert. An Schnorcheln ist nicht zu denken. Nun schon mal auf der Insel, machen wir einen Erkundungsgang und genießen auch die Ruhe und Abgeschiedenheit. Beim Abendessen sitzen wir allein auf der Terrasse. Nur der Haushund Jack leistet uns Gesellschaft und freut sich über die Fischreste. Und weil um zehn Uhr das Stromaggregat abgeschalten wird, heißt es auch bald schlafen gehen.
An Schnorcheln ist auch am nächsten Tag nicht zu denken. Zum Unverständnis der jungen Holländerin und vermutlich auch der Einheimischen, die das Hotel bewirtschaften, fahren wir am nächsten Tag um 10 Uhr zurück nach Manado. Diesmal bleibt das unangenehme Waten durch den Dreck am Hafen erspart, weil der Bootsmann gnädig ist und am Steg anlegt. Lediglich der stämmige Indonesier mit Südseewurzeln und Plattfüßen mit jeweils sechs Zehen, kommt nochmal zu Einsatz, als er die Koffer zum Auto tragen muss. Das ist sein Job. Er schleppt Kisten, gestapelte Eierkartons, Bananenstauden vom Land auf die Boote, die die umliegenden Inseln versorgen. Manchmal auch Menschen, so wie Evelyn einen Tag zuvor.

Manado, das, wie wir jetzt wissen, vor zwei Wochen unter Wasser gestanden hat, gibt nicht wirklich was her. Als Ausgangspunkt für die Erkundung von Nord-Sulawesi ist sie aber ideal, die Hauptstadt der Provinz Sulawesi Utara. Mittlerweile hat die reiche Stadt ungefähr 500.000 Einwohner und ist von einer schönen Berglandschaft mit Seen und Vulkanen umgeben. Ihren Wohlstand verdankt die Stadt dem Gewürzhandel. Der Naturforscher Alfred Russell Wallace hat sie Mitte des 19. Jahrhunderts besucht und als eine der schönsten Städte Asiens beschrieben. Nach ihm ist auch die Wallace-Linie benannt, die zwischen den indonesischen Inseln Borneo und Celebes eine biogeographische Grenze ist. Beim Abheben vom Manado Airport in Richtung Jakarta am nächsten Morgen zeigt sich die Stadt im Norden dann auch nochmal von ihrer schönsten Seite: bei Sonnenaufgang wirkt sie aus der Luft betrachtet tatsächlich wie ein kleines Juwel inmitten eines tropischen Regenwaldes und einer türkisfarbenen Manado Bay. Vielleicht hat Wallace ja recht gehabt. Seit 1991 ist die Region hier Marine Nationalpark und beherbergt eine faszinierende Unterwasserwelt, die uns diesmal verschlossen geblieben ist. Eine Gelegenheit mehr, wieder herzukommen und einen weiteren Versuch zu starten. In der Trockenzeit.